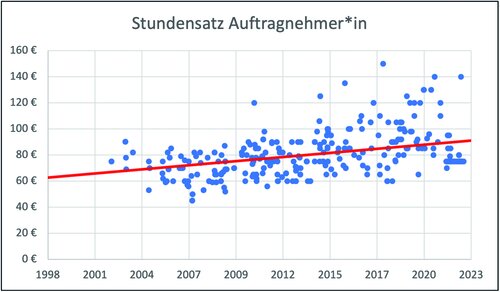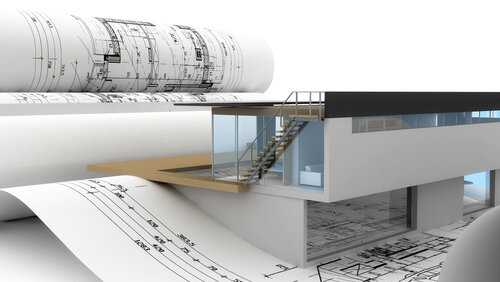Nach der Entscheidung des EuGH vom 04.07.2019 in der Rs. C-377/17, wonach die Mindest- und Höchstsätze der HOAI nicht konform zum EU-Recht sind, stellen sich einige nun die Frage, ob sie an die bestehenden Verträge gebunden bleiben oder ob sie die Verträge einseitig beenden können. Antwort: Eine einseitige Vertragsbeendigung ohne finanzielle Nachteile ist unwahrscheinlich.
Frage 1: Ein Planer: „Ich habe mich vor zwei Jahren auf einen Vertrag eingelassen, der nur die Mindestsätze der HOAI ausweist. Damals hatte ich nicht viel zu tun und war auf den Auftrag angewiesen. Heute stelle ich fest, dass ich mit dem vereinbarten Honorar nicht auskomme und aktuell deutlich bessere Honorare bekommen kann. Komme ich aus dem Vertrag heraus?“
Frage 2: Ein Auftraggeber: „Im Mai dieses Jahres habe ich ein VgV-Verfahren abgeschlossen und zum Mindestsatz vergeben, obwohl ich auch Angebote vorliegen hatte, die darunter lagen. Kann ich den Vertrag kündigen, weil ich heute weiß, dass die HOAI nicht konform zum EU-Recht ist, und neu ausschreiben? Denn heute dürfte ich ja günstigere Angeboten werten und beaufschlagen.“
Vorab zu einer freien Kündigung
Eine freie Kündigung ist für den Auftraggeber zwar möglich, aber nachteilig. Denn dann erhält der Planer das Recht auf volle Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen und abzüglich (relevanter) Ersatzaufträge, die er hatte oder um die er sich vergeblich bemühte (§ 648 BGB). In Verträgen sind diese Abzugspositionen meist mit 40 % oder 60 % vereinbart. Eine solche Kündigung lohnt sich für den Auftraggeber also nicht.
Dem Planer wird in Verträgen meist schon kein Recht auf freie Kündigung eingeräumt. Kündigt er dennoch, wird es zu Schadensersatzforderungen des Auftraggebers kommen.
Eine freie Kündigung wird sich also auch dem Planer nicht anbieten. Eine solche Kündigung soll hier nicht weiter besprochen werden.
Vorab zu einer außerordentlichen Kündigung
Vielmehr ist zu prüfen, ob sich aus dem EuGH-Urteil ein außerordentliches Kündigungsrecht ergeben kann. Die erste Norm hierzu wäre § 648a BGB, der für die bei Planungsleistungen in der Regel vorliegenden Werkverträge gilt. Dieser lautet: „Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werks nicht zugemutet werden kann.“
Hier müsste also der Kündigende darlegen und im Streitfall beweisen, dass für ihn die Fortsetzung des Vertrags unzumutbar ist. Ob das EuGH-Urteil zur HOAI eine Unzumutbarkeit stützt, ist zweifelhaft. Zwar ist das EuGH-Urteil ein neuer Umstand. Aber warum soll deshalb eine Vertragsfortsetzung als solche (!) unzumutbar sein? „Pacta sunt servanda“, Verträge sind einzuhalten.
Eine andere Frage ist die Vergütung anhand einer seit 40 Jahren existierenden und bis 04.07.2019 von niemandem als unzumutbar bewerteten HOAI, die plötzlich unzumutbar sein soll. Eine Unzumutbarkeit mit dem Ziel einer Vertragsbeendigung ist also nicht erkennbar, sodass § 648a BGB keine folgenlose Kündigung ermöglicht. Sie würde von den Gerichten in eine freie Kündigung mit der beschriebenen Kündigungsfolge einer Stornorechnung oder Schadensersatzforderung umgedeutet. Zum selben Ergebnis kommt man, wenn man die Verträge als Dauerschuldverhältnisse nach § 314 BGB kündigen will. Auch dort wäre eine Unzumutbarkeit zweifelhaft.
Hinzu käme, dass § 314 Abs. 3 BGB regelt: „Der Berechtigte kann nur innerhalb einer angemessenen Frist kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat.“ Will sich ein Vertragspartner auf das EuGH-Urteil als Kündigungsgrund beziehen, müsste er zeitnah reagieren. Denn das Urteil ist seit 04.07.2019 allgemein bekannt.
Sodann müsste man darüber spekulieren, was genau als „Kündigungsgrund“ gilt: das Urteil selbst oder dessen Folgen für laufende Verträge, die derzeit von verschiedenen Oberlandesgerichten kontrovers beurteilt werden. So liefert auch § 314 BGB keinen wirklich klaren Ansatz.
Weiter könnte sich eine Vertragspartei auf § 134 BGB beziehen. Dieser regelt: „Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.“
Dies war die Norm, auf die sich eine Partei vor dem Urteil des EuGH beziehen konnte, wenn Mindestsätze unter- oder Höchstsätze überschritten wurden. Dann nämlich war das Rechtsgeschäft insoweit nichtig. Bei zu niedrigen Honoraren konnte der Mindestsatz, bei zu hohen Honoraren der Höchstsatz gefordert werden. Haben aber die Parteien ein Honorar zwischen den Höchst- und Mindestsätzen vereinbart, haben Sie früher schon nicht gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen. Und das tun sie auch heute nicht. Denn der EuGH hat nicht festgestellt, dass eine Honorarvereinbarung zwischen Mindest- und Höchstsätzen gegen EU-Recht verstoße, sondern nur, dass die verbindlichen Mindest- und Höchstsätze der HOAI nicht dem EU-Recht entsprechen. § 134 BGB liefert also keinen Ansatz für eine Unwirksamkeit eines geschlossenen Vertrags. Auch 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) wäre zu prüfen. Dieser regelt in Abs. 1: „Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.“
Eine Partei könnte argumentieren, dass sie den Vertrag so nicht geschlossen hätte, wenn sie das Urteil des EuGH gekannt hätte. Das allein reicht aber auch bei § 313 BGB nicht. Denn auch bei § 313 BGB ist Bedingung, dass ein Festhalten am Vertrag unzumutbar ist. Wie schon zu § 648a BGB ausgeführt, ist auch hier die Unzumutbarkeit nicht schlüssig darstellbar. Demnach ist eine folgenlose Kündigung auch nicht von § 313 BGB gedeckt.
Auf diesen Grundlagen hat die GHV die Fragen beantwortet:
Antwort 1: Auf Nachfrage hat der Planer bestätigt, dass im Vertrag kein freies Kündigungsrecht geregelt ist. Um einen berechtigten Grund zu haben, müsste er also eine Unzumutbarkeit als Voraussetzung für eine Kündigung, sei es nach § 313 BGB, nach § 314 BGB oder nach § 648a BGB, überzeugend anführen. Warum aber ein Festhalten unzumutbar sein soll, weil der Planer heute mit neuen Verträgen mehr verdienen kann als mit dem alten Vertrag, ist nicht erkennbar. Zudem gälte es, neben den Interessen des Planers auch die berechtigten Interessen des Auftraggebers zu beachten, der sicher am Vertrag festhalten will. Eine Kündigung ist für den Planer ohne Schaden nicht möglich.
Antwort 2: Für den Auftraggeber könnte man zunächst zu dem Ergebnis kommen, dass er tatsächlich den Vertrag so nicht geschlossen hätte, wenn er das EuGH-Urteil gekannt hätte. Entsprechend wäre eine Voraussetzung für § 313 BGB gegeben. Allerdings dürfte auch hier der weitere Weg an einer erforderlichen Unzumutbarkeit scheitern. Zudem ist es aktuell noch gar nicht sicher, wie das Urteil des EuGH in laufende Verträge eingreift (siehe Kalte/Wiesner im Deutschen Ingenieurblatt 10/2019). Denn wenn der BGH zum Ergebnis kommt, dass eine richtlinienkonforme Auslegung von § 1 HOAI (Beschränkung der HOAI auf Ingenieure und Architekten) möglich oder die Entscheidung des OLG Hamm richtig ist (und nicht die des OLG Celle), dann müsste der Auftraggeber bis zu einer neuen HOAI weiterhin die Mindestsätze der HOAI beachten. Zumindest ist eine Kündigung auch für den Auftraggeber ein riskantes Unterfangen.
Fazit
Der EuGH hat am 04.07.2019 entschieden, dass die Mindest- und Höchstsätze der HOAI nicht konform zum EU-Recht sind. Ein wichtiger Grund zur Kündigung von laufenden Verträgen ist aus dem Urteil jedoch nicht ableitbar. Das scheitert, unabhängig von der Rechtsgrundlage, daran, dass eine Unzumutbarkeit des vereinbarten Honorars schwerlich zu belegen ist. Verträge sind also zu halten, oder, wie der Lateiner sagt: Pacta sunt servanda. Zudem ist noch keine Rechtssicherheit gegeben, dass bestehende Honorarvereinbarungen oder jetzt neu abzuschließende Verträge nicht doch die HOAI zu beachten haben.